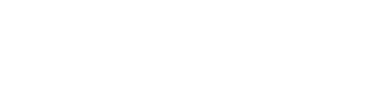„Ich hätte mehr Zeit mit ihm verbracht“
„Ich hätte mehr Zeit mit ihm verbracht. Er hat mich gefragt, ob wir einen Film zusammen anschauen und ich bin lieber mit meinen Freunden spielen gegangen.“
Die junge Dame, mit der ich spreche, ist inzwischen 12 Jahre alt. Ihr Vater ist an seiner Krebserkrankung gestorben, als sie 8 Jahre alt war. Als ich sie das erste Mal sah, lag sie mit 12 Monaten in einem Maxi-Cosi und ich sprach mit ihren Eltern über die möglichen Behandlungen.
Es ist für mich als Onkologe die seltene Gelegenheit, die Sicht eines Kindes zu erfahren, dass zwei Drittel seines bisherigen Lebens mit der Krankheit und dem drohenden Verlust eines Elternteils umgehen musste. Ich frage mich, ob und was wir als betreuende Ärzte anbieten sollten, um den Kindern unserer Patienten (-innen) zu helfen, ein psychisch gesundes Leben zu führen.
Wir unterhalten uns über Krebs und ob E. wusste, was Krebs ist und dass ihr Vater daran sterben würde. Zunächst verneint sie, dass ihre Mutter ihr gesagt hat, dass die Krankheit nicht heilbar ist. Im Verlauf des Gespräches sagt sie plötzlich: „doch, Mama hat mir gesagt, dass er sterben muss, aber ich konnte es nicht glauben und habe es wieder verdrängt, weil ich es mir sowieso nicht vorstellen konnte. Als er dann gestorben ist, wusste ich, was Mama meinte.“
Ich erzähle ihr von der ersten Begegnung ganz zu Beginn der Therapie und dass ich sie anschließend nicht mehr gesehen habe. Es interessiert mich, ob es ihr geholfen hätte, mit in die Sprechstunde zu kommen und zu sehen, was in der Praxis passiert. Ihre Antwort ist „ja – vielleicht, aber ich war immer im Kindergarten oder der Schule, wenn er bei dir war.“
E. kennt inzwischen die Räume der Praxis und ich habe ihr erzählt, was wir dort machen. Sie stellt sich vor, dass ihr Vater dort sitzt und eine Infusion bekommt. Auf meine Frage, ob sie von mir Informationen gebraucht hätte, antwortet sie mit „Nein.“
Beim finalen Sterben war sie nicht dabei. „In der Nacht vorher haben Mama und ich auf einer Matratze im Wohnzimmer geschlafen und Papa lag auf dem Sofa. Dort war er am liebsten. Er hatte so eine Pumpe mit Medikamenten und hat den ganzen Tag geschlafen und nicht mehr geantwortet. Mama hat mich irgendwann ins Bett getragen – das war unfair.“
Die Erklärung, dass ihr Vater in der Nacht heftig erbrochen hat und nicht gestorben war, reichen ihr in dem Moment aus. Sie hat bis heute Schwierigkeiten mit Übelkeit und Erbrechen und bekommt sofort Panik. „Er hat in den letzten Wochen immer wieder mal gebrochen und das war immer schlimm für mich.“
Am Morgen wurde sie von ihren Großeltern abgeholt, hat sich von ihrem Vater mit einem Kuss verabschiedet, um etwas „Schönes“
zu machen. Sie empfindet es heute als „ein komisches Gefühl“
, dass sie Spaß hatte, während ihr Vater gestorben ist. „Oma hat dann einen Anruf von Mama bekommen und wir sind nach Hause gefahren. Alle haben geweint und ich war mittendrin und konnte nicht weinen. Dann sind seine Eltern gekommen und seine Mutter ist auf den Boden gefallen und hat geschrien. Das fand ich ganz schlimm. Ich bin dann in mein Zimmer gelaufen, habe geweint und dann gespielt.“
Die Psychoonkologin unserer Praxis, mit der ich mich über diese Situation unterhalten habe, erklärte, dass Kinder im Unterschied zu Erwachsenen „Trauerpfützen“
haben. Sie sind emotional nicht in der Lage, längere Zeit ohne Unterbrechung zu trauern. Sie sind in diesem Moment zutiefst belastet, um nach kürzester Zeit unbeschwert zu spielen. Das ist normal und notwendig. Die langanhaltende kontinuierliche Trauer lernen wir erst im späten Jugendalter.
„Dann musste ich mich ein ganzes Jahr um Mama kümmern. Sie hat immer wieder geweint und ich habe versucht, sie abzulenken. Immer, wenn im Fernsehen etwas Trauriges kam, hat sie geweint. Wir haben auch oft gestritten – aber das war besser als weinen.“
In ihrer Wahrnehmung hat sie sich verantwortlich gefühlt, ihre Mutter glücklich zu machen; und wenn das nicht gelang, dann wenigstens wütend – das war besser als traurig.
Neben der eigenen psychoonkologischen Betreuung hat E.´s Mutter ihre Tochter in einer Kindertrauergruppe angemeldet. Mich interessiert, ob ihr das geholfen hat. „Nein – eigentlich habe ich das nur für Mama gemacht. Es waren alles fremde Menschen und ich wusste nicht, was ich denen erzählen sollte.“
Ich frage sie, mit wem sie sich denn besser unterhalten hätte? „Mit den Menschen, die ihn kannten. Mit meinen Großeltern – ich liebe es, wenn ich Geschichten aus seiner und meiner Kindheit höre; Erlebnisse, die wir gemeinsam hatten und die ich anfange zu vergessen. Wenn ich sie erzählt bekomme, erinnere ich mich wieder daran. Aber ich frage nicht so oft danach, weil Oma und Opa dann traurig werden und weinen – das will ich nicht.“
Leider hat E. nur wenig Kontakt zu den Eltern ihres Vaters. Sie sind bis heute in ihrer eigenen Trauerarbeit nur wenig vorangekommen und geben damit ihrer Enkelin kaum Gelegenheit, die Erinnerungen an ihren Vater lebendig zu halten. Wie schön könnte es für alle Beteiligten sein, Geschichten aus der Vergangenheit auszutauschen, zu lachen und vielleicht auch gemeinsam zu weinen, ohne dass es „schlimm sein muss.“
Ich freue mich über den Kontakt zu E. und überlege mir, welche Konsequenzen ich daraus für meine eigene Arbeit ziehe:
1. Nach vorheriger Absprache dürfen Kinder krebskranker Eltern mit in die Praxis kommen; sie sehen die Räume und die Abläufe und die Therapie bleibt kein „blinder Fleck.“
2. Ich biete den Eltern an, dass wir ein gemeinsames Gespräch über die Krankheit führen; mir ist sehr wohl bewusst, dass ich die Worte „anders“
wähle und dass auch auf meiner Seite Übung und Bewusstsein dazu gehören.
3. Es ist in Ordnung, wenn die Kinder während des Gespräches „nur dabei“
sind. Altersabhängig spielen sie auf dem Handy oder beschäftigen sich mit anderen Dingen. Ich erlebe, dass sie passiv zuhören. Meine Rückfrage am Ende des Gespräches, ob sie noch etwas wissen möchten und das Angebot, dass sie wieder mitkommen können, wird sowohl von den Eltern wie auch den Kindern positiv aufgenommen.
4. Die onkologische Behandlung meiner Patienten geht weit über das Verabreichen eines Medikamentes hinaus und das soziale Umfeld insbesondere bei jungen Erkrankten muss in die Therapie mit einbezogen werden.
5. Die Möglichkeit der psychoonkologischen Unterstützung in der Praxis ist von unschätzbarem Wert.
6. Ich bin dankbar für die Erfahrung durch das Interview mit der jungen Dame!
Autor: Olav Heringer, Gemeinschaftspraxis für Hämatologie und internistische Onkologie im Fachärztezentrum Medicum, Wiesbaden