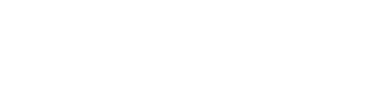Ist die Gesetzesänderung auch in Ihrer Praxis vertretbar
Ein Beschluss des 121. Ärztetags in Erfurt hat es im Mai 2018 in praktisch sämtliche Tagesnachrichten geschafft: Die Lockerung des Verbots der ausschließlichen Fernbehandlung. Was auf den ersten Blick vorsichtig formuliert wirkt, hat das Potenzial, die Digitalisierung im Gesundheitswesen einen großen Schritt voranzubringen. Denn es ist ein klares „Ja“ für den Ausbau der Telemedizin.
Das Coronavirus Sars-CoV-2 dürfte jetzt auch die hartnäckigsten Tele-Kritiker zum Umdenken zwingen. Vom Gesundheitsministerium über die Kassenärztliche Vereinigung bis hin zu den regionalen Hausärzteverbänden erklang in den letzten Tagen der deutliche Aufruf dazu, dass Ärzte verstärkt von Videosprechstunden Gebrauch machen sollten. Wie jedoch etwa die Kassenärztliche Bundesvereinigung alarmiert feststellte, ist das Equipment für Videosprechstunden aktuell noch nicht flächendeckend vorhanden.
In § 7 Abs. 4 der geänderten ärztlichen (Muster-)Berufsordnung MBO-Ä heißt es jetzt wörtlich: „Eine ausschließliche Beratung oder Behandlung über Kommunikationsmedien ist im Einzelfall erlaubt wenn dies ärztlich vertretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorgfalt insbesondere durch die Art und Weise der Befunderhebung, Beratung, Behandlung sowie Dokumentation gewahrt wird und die Patientin oder der Patient auch über die Besonderheiten der ausschließlichen Beratung und Behandlung über Kommunikationsmedien aufgeklärt wird.“
Mit der gegenwärtigen Corona-Krise befinden wir uns in einer Extremsituation. So sind erkrankte Personen angehalten, sich vor dem Praxisbesuch zunächst an den Bereitschaftsdienst unter 116117 zu wenden und Krankschreibungen können sogar telefonisch erfolgen. Es gibt Fernbehandlungsportale wie die Deutsche Arzt AG oder Arztkonsultation.de, die nun schlagartig bekannter werden dürften.
Doch was ist ärztlich vertretbar und wie sieht die Bereitschaft zur Telemedizin aus, wenn die Extremsituation der Corona-Krise vorüber ist? Darüber ist sich die Deutsche Ärzteschaft offenbar alles andere als einig. So sind die Ärztekammern Brandenburg und Saarland bislang klar gegen eine ausschließliche Fernbehandlung. In Brandenburg begründete man dies im September 2018 mit einem „unkalkulierbaren Risiko für Arzt und Patient“ (Quelle: Ärztezeitung). Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Baden-Württemberg hingegen verkündet praktisch zeitgleich den landesweiten Ausbau ihres Modellprojekts „docdirekt“, das Kassenpatienten des Landes ermöglicht, sich von einem Tele-Arzt kostenlos beraten zu lassen.
Fernbehandlung – die Haltung der Kassen
Die technische Infrastruktur für docdirekt stellt der Münchner Anbieter TeleClinic bereit, der seit der Lockerung des ausschließlichen Fernbehandlungsverbots auch über eine eigene Plattform Online-Sprechstunden bei deutschen Ärzten vermittelt. Weil TeleClinic immer mehr Kooperationen mit Krankenversicherungen schließt, erhalten auch immer mehr Patienten in Deutschland Zugang zu einem nationalen Telebehandlungsangebot. Inzwischen bieten einige Krankenkassen sogar eigene Videosprechstunden mit Vertragsärzten an, wie beispielsweise die DAK.
Einstiegsmöglichkeiten für Ärzte
Ärztinnen und Ärzte, die Fernbehandlungen durchführen wollen, haben verschiedene Einstiegsmöglichkeiten:
Unkompliziert und wirtschaftlich ist es, Fernsprechstunden über einen Anbieter wie TeleClinic abzuhalten. Die Registrierung ist kostenlos, als Bewerber muss man eine ärztliche Approbation vorweisen und eine verifizierte digitale Unterschrift einreichen, wenn eRezepte ausgestellt werden sollen. TeleClinic stellt seinen Partnerärzten dann seine Software zur Verfügung und schult sie in deren Anwendung.
Alternativ können Praxen ein eigenes telemedizinisches Angebot kreieren und dazu Lösungen spezialisierter Softwarenanbieter wie beispielsweise Telemedo nutzen. Eine sichere, weil verschlüsselte Kommunikation zwischen Arzt und Patient ermöglicht auch Minxli, hier benötigen Arzt und Patient für eine Online- bzw. Videosprechstunde ein Smartphone, die passende App und jeweils einen Account bei dem Münchner Startup.
Das beliebte Kommunikationsprogramm Skype ist aus Sicherheitsgründen für einen Austausch sensibler Daten nicht geeignet und sollte daher nicht für die Arzt-Patienten-Kommunikation genutzt werden. (Quelle: Universität Gießen)
Die „normalen“ Grenzen der Fernbehandlung nach der Corona-Zeit
Grundsätzlich können Ärzte laut geänderter MBO-Ä ihre Patienten jetzt ohne vorherigen persönlichen Kontakt telefonisch oder per Internet beraten und behandeln. Ein besonderes Augenmerk liegt jedoch auf der Formulierung „im Einzelfall erlaubt“. Möglicherweise möchte der Ärztetag damit der Auffassung vorbeugen, Fernbehandlungen könnten den Arzt-Patienten-Kontakt ersetzen und dem Patienten eine gleichwertige und gleichzeitig bequemere Behandlungsmethode bieten.
Aufgrund einiger Bedenken von Skeptikern gab es im Rahmen der Neuregelung der MBO-Ä zudem einschränkende Entschließungsanträge – zum Beispiel dazu, dass Fernbehandlungen in bestehende Versorgungsstrukturen eingebunden und im vertragsärztlichen Sektor nur durch Vertragsärzte im Rahmen des Sicherstellungsauftrags durchgeführt werden sollen. Zudem dürfen Ärzte nicht per Telefon oder Videokonferenz krankschreiben, wenn ihnen der Patient bislang unbekannt war. Uneinigkeit besteht weiterhin in der Frage, ob es Ärzten künftig erlaubt sein soll, Verordnungen und Überweisungen online auszustellen. Eine solche Regelung bedarf vermutlich der Zustimmung durch den Gesetzgeber.
(Quelle: medizinanwalt.de)
Arne Müßig, Pro- und Contra
Die eierlegende Wollmilchsau. Nichts Geringeres soll dieses Fabelwesen „Telemedizin“ in der ambulanten Versorgung von Patienten in Zukunft bedeuten. Höheres Patientenaufkommen durch immer mehr werdende alte PatientInnen: Kein Problem. Weniger Personal zur Versorgung: Kein Problem. Kostenexplosion aus dieser ansteigenden Versorgungslast: Wird kompensiert. Qualität der Versorgung: Wird dadurch natürlich auch noch gesteigert. Datenschutz und Sicherheit: Selbstverständlich! Und was werden wir aus der Zeit des Corona-Virus für die Telemedizin gelernt haben?
Die Wunschliste der Politik ist lang, die Hoffnungen groß. Und die Patienten sollen auch mit dieser neuen Form des Arztkontakts zufrieden sein. Medizin 2.0, vom Tablet-PC oder Telefon vom Sofa aus erreichbar.
Aber rieche ich auch den Atem des Patienten durch das Telefon? Kann ich eine Mukositis wirklich über die Kamera am Display beurteilen? Und was ist, wenn ich mich irre und wenn es nicht mehr nur um die Frage „Corona Ja/Nein“ geht? Wenn der Patient durch das kleine Display noch munter spricht, sich aber geradewegs auf dem Weg in die Sepsis befindet. Ihn nach einem Gespräch mit mir zur Blutbildkontrolle und CRP-Wertbestimmung in unser Praxislabor zu schicken fällt telemedizinisch aus. Ersetzt das alte Quecksilberthermometer, das ich dem Patienten fernmündlich zur Diagnostik als einzig in seinem Haushalt verfügbares Werkzeug zu benutzen rate meine Möglichkeiten adäquat? Verträgt sich das mit dem Begriff der „ärztlichen Sorgfalt“, die unsere ärztliche Berufsordnung uns im Kontext der Telemedizin zu Recht vorschreibt?
Einen Pflegedienst zum Patienten zu schicken, der eine Blutentnahme und geschulte Statuserhebung qualifiziert und zeitnah vor Ort erledigt: Vom Pflegenotstand in der ambulanten Versorgung möchte ich in diesem Artikel eigentlich nicht schreiben. Und schon gar nicht vom Ärzte- und Pflegenotstand in Regionen, in denen telemedizinische Betreuung zunächst sinnvoll erscheint: Weit weg von den Metropolen auf dem Land. Der Begriff „alleingelassen“ bekommt in diesem Kontext ein nur virtuelles „Begleitetwerden“ am Patientenbett durch bits und bytes zur Antwort.
In einer von mir initiierten nicht repräsentativen Umfrage unter onkologischen KollegInnen kam heraus, dass mindestens 80% der eingegangenen telemedizinischen Anfragen nach der ersten Kontaktaufnahme in die Antwort münden: Das kann ich Ihnen verantwortungsbewusst nur in der Praxis bei mir beantworten. Ich (video-)telefoniere also und sehe die meisten Patienten anschließend trotzdem. Zeitersparnis? Die verbleibenden gefühlten 20% der Patienten, die in den zumeist telefonisch geführten Anfragen ohne eine Vorstellung in der Praxis auskommen, geben mir oder über Umwege zu verstehen: Das ist keine emotional befriedigende Betreuung. Die Stimme am Telefon ersetzt nicht ausreichend die körperliche Nähe, das aufmunternde in den Arm genommen werden nach der Untersuchung. Ein: „Das wird schon!“ verhallt im Alleinsein nach dem Beenden unserer telemedizinischen Verbindung sehr schnell. Das Gefühl von Sicherheit und Hoffnung, dass Patienten nach einem realen Arztkontakt haben, wird bei weitem nicht erreicht.
Die Gebührenordnung der ärztlichen Leistungen beinhaltet in ihrer Bemessung auch das Komplettpaket aus bereitgestellten Ressourcen zur Versorgung meiner Patienten: Räume, Personal, Zeit, Material, Qualifikation. Was rechne ich ab, wenn ich meine Arbeit theoretisch allein in einem telefonzellengroßen Büro erledigen könnte? Ist meine Tätigkeit dann weniger wert? Was sagt meine Versicherung zum Thema Irrtum und Behandlungsfehlern im Rahmen meiner telemedizinischen Arbeit?
Die Bedürfnisse nach Versorgungslösungen in unserem Gesundheitssystem für die Zukunft sind klar umrissen. Die Voraussetzungen für eine verantwortungsbewusste und definierte Telemedizin sind allerdings bisher unzureichend geschaffen worden (unter anderem auch die Erschaffung neuer Berufsgruppen für qualifizierte Unterstützung des Telemediziners vor Ort). Ein Gesetz und eine Änderung der ärztlichen Berufsordnung lassen die eierlegende Wollmilchsau eben nicht physisch vor mir stehen. Sondern allenfalls den Traum vom Fabelwesen…
Autor: Arne Müßig,
Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie am MVZ Havelhöhe, Berlin
Olav Heringer, Pilotstudie „Rettungseinsatz“
Ärzte werden in Deutschland weniger – das ist schon länger kein Geheimnis. Parallel nimmt die 50+ Bevölkerung durch die geburtenstarken Jahrgänge rasch zu und somit auch die behandlungsbedürftigen Patienten. Es gibt bisher wenig innovative Ideen, wie in 10 Jahren die Versorgung der Menschen gelingen kann.
Unstrittig bleibt, dass für bestimmte Fragestellungen die Expertise eines Arztes benötigt wird. Der Rettungsdienst ist hierfür das beste Beispiel. Patienten oder Angehörige melden sich bei der Leitstelle und schildern das Problem. Zunächst wird es als nicht bedrohlich eingeordnet und ein Rettungswagen zur Einsatzstelle geschickt. Hier gestaltet sich die Situation nicht eindeutig, so dass der nächste verfügbare Notarzt nachgefordert wird. Dieses Vorgehen ist bisher der Standard und ein Großteil der Verantwortung liegt in den Händen des Leitstellenmitarbeiters, das richtige Rettungsmittel auszuwählen.
Hier starten gerade die ersten Pilotprojekte zum Thema Telemedizin. Der Rettungsassistent ist über ein Headset mit dem Notarzt verbunden. So kann dieser das Gespräch mit dem Patienten verfolgen. Wird der Betroffene in den Rettungswagen gebracht, kann sich der Kollege auch optisch zuschalten. Er hat einen Blick auf den Patienten sowie die Monitore. Über diese Module kann der Notarzt Entscheidungen zu medikamentöser Therapie oder der Nachforderung zusätzlicher Rettungsmittel entscheiden. Er kann somit innerhalb kurzer Zeit mehrere Patienten sehen und telemedizinisch mit betreuen.
Wie sieht es in der onkologischen Versorgung mit Telemedizin aus? Können hier die technischen Möglichkeiten ebenfalls genutzt werden? Was sind die Einsatzmöglichkeiten? Aktuell erhalte ich pro Tag ca. 20 E-Mails von Patienten, die bis zu 50 km entfernt wohnen und Fragen, Beschwerden oder Nebenwirkungen der Behandlung thematisieren und sich einen Ratschlag wünschen. Mehrfach rufe ich diese Menschen an, denn die geschriebene Sprache ist nicht immer eindeutig oder ich habe Nachfragen, die mir helfen, besser zu verstehen. Würde mir ein Blick auf den Patienten durch Telemedizin helfen? Die moderne Technologie kann einige Daten wie Herzfrequenz, EKG, Atemfrequenz etc. ermitteln! Helfen die verfügbaren Daten in der Onkologie zur Entscheidungsfindung?
Autor: Olav Heringer,
Gemeinschaftspraxis für Hämatologie und internistische Onkologie im Fachärztezentrum Medicum, Wiesbaden